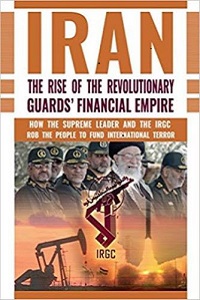NWRI:
„Sie flehten uns an, nicht anzugreifen. Sie gaben uns sogar die Koordinaten ihrer eigenen Stützpunkte.“
Mit dieser Erklärung behauptete Mahmoud Nabavian, stellvertretender Leiter der iranischen Nationalen Sicherheitskommission, die USA hätten aus Angst vor Teherans Reaktion auf israelische Angriffe ein Angriffsziel geboten. „Wir haben es nicht akzeptiert“, sagte er stolz . „Wir haben zugeschlagen, wo wir wollten.“ Für die Hardliner des Regimes war dies ein Triumph. Doch für kritischere Augen war es eine Show – laut, wild und hohl. Ein Regime, das große Töne spuckt, nicht weil es stark ist, sondern weil es Angst davor hat, als das gesehen zu werden, was es ist: in die Enge getrieben, geschwächt und von seinen eigenen Fußsoldaten nicht mehr gefürchtet.
Was Irans Herrscher nun erleben, ist nicht nur ein militärischer Rückschlag oder eine internationale Rüge. Es ist ein Zusammentreffen von Krisen – innenpolitischen, regionalen und globalen –, das die klerikale Diktatur ihrer strategischen Tiefe beraubt hat, die sie über Jahrzehnte aufgebaut hat. Vom Präsidentenpalast bis zur Kaserne der IRGC ist die Panik unverkennbar. Und es ist ihre eigene, zusammenbrechende Machtbasis, die ihnen am meisten Angst macht, nicht Washington oder Tel Aviv.
Die höchsten Vertreter des Regimes äußerten sich im Rundfunk mit einer seltsamen Mischung aus Großspurigkeit und Paranoia. Der stellvertretende Außenminister Kazem Gharibabadi behauptete, der Iran sei nach dem zwölftägigen Krieg „siegreich“ und beharrte darauf, seine „prinzipiellen Positionen“ in der Diplomatie seien unverändert geblieben. Der IAEA ist der Zugang zu den iranischen Atomanlagen nun verwehrt. Im staatlichen Fernsehen warnte Mohammad-Javad Larijani, Europa sei möglicherweise nicht länger sicher, und schon bald könnten „fünf Drohnen“ eine nicht genannte europäische Stadt angreifen. Er sinnierte sogar düster über einen Fall von US-Präsident Donald Trump, der während seines Urlaubs in Florida von einer Drohne „am Nabel getroffen“ worden sei – eine Rhetorik, die sich an der Grenze zwischen Fantasie und Drohung bewegt. Gleichzeitig forderte die Tageszeitung Kayhan, deren redaktionelle Linie als auf der Linie des Obersten Führers Ali Khamenei stehend gilt, offen die Hinrichtung von IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi und beschuldigte ihn der Mittäterschaft bei den israelischen Angriffen.
Strategischer Zusammenbruch
Diese bombastischen Erklärungen sind kein Zeichen der Macht. Sie sind der Ausdruck eines Regimes, das verzweifelt versucht, seine Autorität zu demonstrieren, während es die Kontrolle verliert.
Regional gesehen erodieren die Säulen von Teherans Stellvertreterreich. Baschar al-Assads Herrschaft in Syrien, einst ein erbitterter Verbündeter des Regimes, ist vorbei. Die Hisbollah ist schwer angeschlagen und im Libanon politisch in die Enge getrieben. Die Houthis im Jemen, die nun zum taktischen Rückzug gezwungen sind, sehen sich einer zersplitterten Koalition und schwindenden Ressourcen gegenüber. Und im Irak orientieren sich selbst die einst gehorsamen schiitischen Milizen neu – einige distanzieren sich offen von Teheran, um ihre lokale Legitimität zu wahren. Die Vorstellung einer vereinten regionalen Front unter iranischem Kommando zerfällt.
Im Inland ist die Erosion noch ausgeprägter. Der zwölftägige Krieg – ungeachtet seiner taktischen Details – führte der iranischen Machtbasis ihre Verwundbarkeit vor Augen. Ihre berühmten Raketenarsenale erwiesen sich als unzureichend. Ihr Kommandonetzwerk war angegriffen. Strategische Einrichtungen, die als undurchdringlich galten, wurden getroffen, zerstört oder enttarnt. Auf den Straßen erlebte die Bevölkerung keine Machtdemonstration, sondern eine Abrechnung .
Risse in der eisernen Faust
Dem Regime ist bewusst, dass genau jene Kräfte, auf die es sich bei der Unterdrückung abweichender Meinungen verlässt – Kommandeure der Revolutionsgarde, Geheimdienstoffiziere, die Basidsch-Truppen –, derzeit mit der Moral zu kämpfen haben. Sie sind keine Ideologen. Sie sind Überlebende. Und sie sind zunehmend unsicher, ob das Regime, das sie verteidigen, noch lange überleben wird.
Deshalb schreien die Teheraner Führer lauter denn je. Das Parlament hat gerade ein umfassendes Gesetz verabschiedet , das praktisch jeden Kontakt mit westlichen Regierungen oder Medien kriminalisiert. Für alles, vom Austausch geheimdienstlicher Informationen bis zum Teilen von Videos im Internet, stehen Todes- oder lebenslange Haftstrafen. Die Nutzung des Satelliteninternets ist verboten. Die Zivilgesellschaft wird zum Schweigen gebracht. All dies signalisiert nicht Entschlossenheit, sondern Rückzug. Nicht Stärke, sondern Verzweiflung.
Nichts davon soll die Schläge glorifizieren, die dem Regime von seinen Gegnern versetzt wurden. Es geht nicht um die Macht anderer, sondern um den eigenen Zerfall des Regimes. Jahrzehntelang sicherte sich Teheran seinen Lebensunterhalt durch Gewaltexport, manipulierte Diplomatie und die Unterdrückung von Opposition im eigenen Land. Nun werden diese Instrumente entweder neutralisiert oder wenden sich gegen das Regime.
Was bleibt, ist eine Diktatur, die die Angst in den Augen ihrer eigenen Vorgesetzten sieht. Also, tritt sie auf – lautstark, dramatisch und ohne Pause. Sie prahlt mit ihrem Sieg, ignoriert aber ihre eigene Isolation. Sie rühmt ihre Widerstandsfähigkeit, während ihre Wirtschaft zusammenbricht. Sie verkündet ihre Stärke, während die Mauern immer dichter werden.
Die Welt täte gut daran, zuzuhören – nicht auf das, was das Regime sagt, sondern auf das, was es offenbart. Denn hinter jedem Gebrüll verbirgt sich ein Zittern. Und in jeder Prahlerei ein Geständnis. Je mehr die Hüter des Regimes die Hoffnung verlieren, desto mehr werden diejenigen, die dieser Tyrannei seit fast einem halben Jahrhundert Widerstand leisten, an Stärke gewinnen – nicht von Fantasien getrieben, sondern von dem wachsenden Gefühl, dass das Ende der klerikalen Diktatur nicht nur möglich, sondern in greifbarer Nähe ist.